Anekdoten eines Lokalisierungsveteranen
01. Feb. 2021
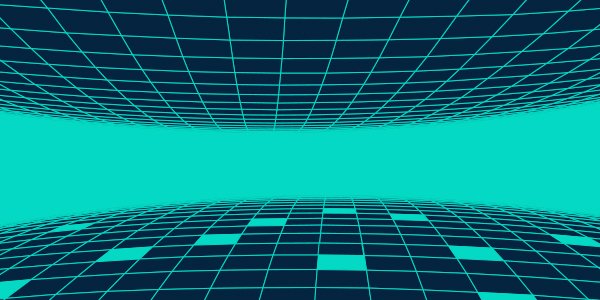
Im August 2020 vollendete ich mein 30. Jahr in der Lokalisierungsbranche (trotz mehrfacher Versuche, ihr den Rücken zu kehren). Angesichts dieses Jubiläums möchte ich einige besondere Erfahrungen schildern, die ich in all den Jahren gemacht habe.
Meine Karriere in der Lokalisierungsbranche begann nach meinem Bachelorabschluss in Französisch, Russisch und International Relations (internationale Beziehungen) an der University of Surrey und meinem Masterabschluss in Artificial Intelligence and Computational Linguistics (künstliche Intelligenz und Computerlinguistik) an der University of Sussex. Vieles von dem, was ich in meinem Masterstudium lernte, ist heute gang und gäbe, aber damals war es zum großen Teil noch graue Theorie, weil Computer einfach noch nicht so viel leisten konnten.
Allerdings hatte ich das große Glück, meine berufliche Laufbahn in der internen Übersetzungsabteilung von Rank Xerox in Welwyn Garden City in der englischen Grafschaft Hertfordshire beginnen zu dürfen. Mein damaliger Arbeitgeber war nämlich seinerzeit schon recht weit fortgeschritten, was die Lokalisierungsprozesse anbelangte. Wir nutzten Tools für die computerunterstützte Übersetzung (CAT) mit einer grafischen Benutzungsoberfläche, die die Übersetzung in ihrem unmittelbaren Kontext anzeigte. Außerdem verfassten wir Texte in vereinfachtem Englisch für die maschinelle Übersetzung (MT) und entwickelten MT-Sprachpaare für SYSTRAN.
Das waren hervorragende Startbedingungen für die darauffolgenden 30 Jahre.
Die Zielgruppe kennen und verstehen
Ich war noch nicht lange im Beruf, als mich jemand bat, einige unsere Übersetzungs-Tools vorzuführen. Dadurch lernte ich eine wichtige Lektion über Präsentationen: Man sollte zunächst herausfinden, was das Publikum schon weiß, und darauf aufbauen. Die Demo war für einen sehr erfahrenen ausländischen Gast unserer Abteilung gedacht, dessen genaue Funktion niemand so recht zu kennen schien. Ich weiß noch, dass er einen großen Cowboyhut trug. Er nahm sich einen Stuhl, setzte sich neben mich und gemeinsam schauten wir auf zwei Bildschirme – auf einem davon war das in Spalten unterteilte Übersetzungs-Tool zu sehen, auf dem anderen die grafische Benutzungsoberfläche des Produkts. Für damalige Verhältnisse war das sehr fortschrittlich. Ich zeigte ihm die Terminologiesuche und das Translation Memory (TM), übersetzte einige Segmente und lud sie in die Benutzungsoberflächen-Simulation, um den Kontext zu präsentieren. Außerdem führte ich ihm vor, wie das Tool auf Platzbeschränkungen hinwies, wenn die Übersetzung länger ausfiel als das englische Original. Ich passte dann die Übersetzung auf dem einen Bildschirm an und übertrug sie auf den zweiten, um zu sehen, ob der Platz ausreichte. Ich erinnere mich noch, wie erleichtert ich war, dass die Demonstration so gut gelaufen war. Mein Gast hingegen drehte sich zu den um uns stehenden Kollegen um und fragte: „Warum müssen wir diesen Mist überhaupt übersetzen?“ – so ist jedenfalls meine ErinnerungWenn das Wort „rosa“ zu lang ist
Ein Problem, das bei der Lokalisierung oft auftritt, zeigte sich bei einem frühen Projekt, an dem ich mitwirkte. Es ging um die Anpassung eines japanischen Kopiergeräts für den europäischen Markt. Der Kopierer konnte verschiedene Farbtöne reproduzieren, die auf der einzeiligen LCD-Anzeige angezeigt wurden. Nach einigen technischen Verzögerungen wurde das Produkt in englischer Sprache lokalisiert, was recht problemlos verlief. Das japanische Wort ピンク für die Farbe Rosa bzw. die englische Entsprechung „pink“ wurden fehlerfrei angezeigt. Bei der Übersetzung ins Finnische gab es jedoch Schwierigkeiten: Das finnische Äquivalent lautet „vaaleanpunainen“ – das war für die LCD-Anzeige einfach zu lang und eine geeignete Abkürzung gab es nicht. Die Lösung war, anstelle der Farbbezeichnungen einfach Nummern anzuzeigen und der Bedienungsanleitung eine Legende mit den dazugehörigen Farben hinzuzufügen.Schwarze Kästchen
Eines der größten Projekte, an denen ich mitarbeiten durfte, war die sehr umfangreiche Übersetzung eines Systems namens DocuTech Production Publisher ins Russische – ein früher Digitaldrucker und in seinem Funktionsumfang damals eine Neuheit. Zum Projekt gehörten Hunderte Seiten mit Hilfetexten, die über einen Touchscreen abgerufen werden konnten. Doch als der nagelneue Chip mit dem englischen Ausgangstext und der russischen Übersetzung aus den USA eintraf und im Gerät installiert wurde, gab es ein Problem. Scheinbar wahllos erschienen auf dem Display mitunter schwarze Kästchen anstelle russischer Buchstaben. Ich war damals noch relativ neu in der Firma und hatte drei Jahre Russisch als Fremdsprache hinter mir. Als Experte für alle Fragen rund um Russisch wurde ich gebeten, mir die Sache anzusehen. Mit meinem russischen Wortschatz auf Konversationsniveau – ausgesprochen nützlich, um sich über die Segnungen der Sowjetunion zu unterhalten (die in der Zeit zwischen meinem Studienabschluss und meinem Berufseinstieg zusammengebrochen war) – hatte ich aber meine liebe Not, eine Bedienungsanleitung für einen Kopierer zu verstehen. Nach einer Weile fand ich heraus, dass die schwarzen Kästchen keineswegs wahllos erschienen, sondern immer da, wo ein sogenanntes Weichheitszeichen hätte stehen sollen (der Buchstabe „ь“). Dieser Buchstabe steht nach bestimmten Konsonanten und verändert deren Aussprache, die dadurch „weicher“ wird. Auch die Bedeutung des Wortes kann sich dadurch verändern. Beispielsweise bedeutet „угол“, in der Umschrift „ugol“, ohne Weichheitszeichen „Ecke“ (Aussprache siehe hier). Fügt man diesem Wort jedoch ein Weichheitszeichen hinzu, also „уголь“ bzw. „ugol’“, wobei der Apostroph für das Weichheitszeichen steht, bedeutet es „Kohle“ (Aussprache siehe hier). Wir riefen das Entwicklungsteam an und erläuterten ihm, was wir herausgefunden hatten. Die Antwort lautete: Auf dem Chip sei nicht genug Platz für alle englischen und russischen Schriftzeichen, also habe man einfach ein paar kyrillische Buchstaben ausgelassen, die nicht so wichtig erschienen. Nach einer kurzen Diskussion ließ sich das Team überzeugen, dass dieser vermeintlich nutzlose Buchstabe eben doch wichtig war. Wir kamen schließlich überein, einige vorrevolutionäre Buchstaben aus dem Zeichensatz zu entfernen – in der Hoffnung, dass sie nach dem Auseinanderbrechen der Sowjetunion nicht wieder in Mode kommen würden – und das Weichheitszeichen wieder hinzufügen.Auf die Plätze, fertig, übersetzen
Des Weiteren hatte ich das Glück, in verschiedene Aspekte der MT eingebunden zu werden. In einem Projekt sollte verglichen werden, was effizienter ist: das Post-Editing einer Raw-MT in einer Umgebung für das Desktop-Publishing (DTP) oder die Übersetzung mithilfe eines CAT-Tools. Damals gab es noch kein Trados. Der neueste Stand der Technik in Sachen CAT war stattdessen ein mit einem Server verbundenes Terminal. Das CAT-Tool umfasste zwei Spalten – Ausgangs- und Zieltext – und eine automatische Wörterbuchsuche mit Tastenkürzeln. Für MT-Zwecke verwendeten wir SYSTRAN-Output, der in Viewpoint – der DTP-Umgebung von Xerox – nachbearbeitet wurde. Dies war seinerzeit fortschrittlicher als alles, was Microsoft zu bieten hatte. Um die Vergleichbarkeit – oder zumindest den Anschein von Vergleichbarkeit – zu gewährleisten, mussten jede Menge Aspekte bedacht werden. Meines Erachtens leisteten wir bei dem Effizienzvergleich gute Arbeit und gingen so objektiv vor wie möglich. Das Ergebnis war jedoch eine Überraschung, zumindest für mich: Tatsächlich gab es zwischen beiden Ansätzen nämlich keinen großen Unterschied. Bei der Dokumentation gab es eine hohe TM-Übereinstimmung, d. h., das CAT-Ergebnis und der MT-Output mit Post-Editing waren nahezu identisch. Als wichtigster Effizienzfaktor erwies sich die Kompetenz des Linguisten im Umgang mit dem CAT-Tool oder der DTP-Umgebung. Heutzutage basieren technisch weiter fortgeschrittene Ansätze auf einer Mischung aus TM und MT. Adaptive Ansätze befinden sich in der Entwicklungsphase. Die wesentliche Erkenntnis von damals gilt aber auch heute noch. Denn in einem Gespräch auf einer MT-Konferenz, an der ich letztes Jahr teilnahm, wurde eine Studie vorgestellt, die zu dem Ergebnis kam, der wichtigste Einflussfaktor auf den Durchsatz eines Post-Editors sei nicht die Qualität der Raw-MT, sondern die Fähigkeit des Post-Editors, effiziente Arbeitsmethoden zu finden. Plus ça change …Obszönes Finnisch
Im Laufe der Jahre habe ich an vielen verschiedenen Lokalisierungsprojekten in der Automobilindustrie und im Schwermaschinenbau gearbeitet. Solche Projekte sind immer interessant, insbesondere wenn sie mit einer Werksbegehung verbunden sind. Einmal beanstandete ein Kunde eine schlechte Übersetzung eines Tools für Fahrzeugdiagnosen und wir sollten untersuchen, wo das Problem lag. Der Kunde war ein britischer Automobilhersteller, der heute nicht mehr existiert (was aber um Himmels willen nicht an dem Diagnose-Tool lag). Wenn ich mich recht entsinne, hielt sich damals eine Gruppe von Ingenieuren aus verschiedenen europäischen Ländern zu Schulungszwecken in Großbritannien auf – die perfekte Gelegenheit, direkt im Werk Feedback zu verschiedenen Sprachen einzuholen. Ich sprach mit Ingenieuren unterschiedlicher Herkunft, die mit dem Tool gearbeitet hatten. Im Gespräch mit den französischen Ingenieuren stellte sich schnell heraus, dass das Problem vor allem mit Variablen und verknüpften Zeichenfolgen zu tun hatte. Beispielsweise gab es die folgenden vier Zeichenfolgen: „{door} open“ ({Tür} geöffnet), „{door} closed“ ({Tür} geschlossen), „{sunroof} open“ ({Schiebedach} geöffnet) und „{sunroof} closed“ ({Schiebedach} geschlossen) – diese wurden aus zwei anderen Zeichenfolgen in der Software erzeugt, nämlich „{item}“ ({Element}) plus „open“ (geöffnet) und „{item}“ plus „closed“ (geschlossen). Im Französischen können die Entsprechungen der Adjektive „open“ und „closed“ jeweils zwei Formen annehmen: „ouverte“ und „ouvert“ bzw. „fermée“ und „fermé“ – je nachdem, ob das dazugehörige französische Substantiv weiblich, wie bei „door“, oder männlich, wie bei „sunroof“, ist. Zum Zeitpunkt der Übersetzung wusste der Übersetzer aber nicht, worauf sich „open“ und „closed“ beziehen, weshalb für die Übersetzung nur die männliche Form gewählt wurde. Daneben gab es noch weitere Internationalisierungsprobleme, aus denen sich typische, unbedingt zu vermeidende Fehler ableiten ließen, die heutzutage jeder in der Sprachservicebranche kennen dürfte. Meine Aufgabe war es, diese Probleme zu melden, damit die Übersetzung angepasst werden konnte – soweit möglich, denn der Quellcode der Software ließ sich in seiner Struktur nicht mehr verändern. Bei den finnischen Ingenieuren stieß ich jedoch auf Granit. Irgendwie hatte ich schon geahnt, dass Finnisch wohl von allen Sprachen die meisten Probleme bereiten würde. Auf Nachfrage berichteten sie, dass jeden Morgen beim Hochfahren des Diagnose-Tools aus irgendeinem mir unbegreiflichen Grund (der wohl kaum mit verknüpften Zeichenfolgen zu tun gehabt haben dürfte) eine Meldung mit einer obszönen finnischen Redewendung erschien. Dieser Umstand sorgte bei den Finnen stets für Heiterkeit, weshalb sie auf keinen Fall eine Änderung wünschten.Das Jahr 2000 und nationale Klischees
Einmal nahm ich eine kurze Auszeit von der Lokalisierung und beteiligte mich stattdessen an einer Untersuchung, mit der festgestellt werden sollte, ob wichtige Standorte in ganz Europa für den Millennium-Bug gerüstet seien. Dabei sollte ich eine amerikanische Führungskraft begleiten, die einen sehr umfangreichen Prüfungsbogen herumgeschickt hatte, den jeder Standort ausfüllen musste. Gemeinsam sollten wir die Standorte besuchen, die Fragen des Prüfungsbogens durchgehen und stichprobenartig die Antworten kontrollieren. Die Reaktionen der Teams in den einzelnen Ländern entsprachen beinahe den typischen nationalen Klischees:- Die Italiener teilten uns mit, wir müssten nicht kommen, weil schon nichts weiter passieren würde.
- Die Deutschen sagten uns ebenfalls, das wir nicht zu kommen bräuchten, weil sie schon alle Fragen gründlich beantwortet hätten.
- Die Schweizer empfingen uns gastfreundlich und führten uns durch den Standort, wo der fertig ausgefüllte Fragebogen längst bereitlag.
- Auch die Franzosen erwiesen uns ihre Gastfreundschaft – mit einer Kaffeepause am späten Vormittag, dann einem üppigen Mittagessen mit Wein, gefolgt von einer weiteren Kaffeepause. Im Grunde sagten sie uns jedes Mal, wenn wir eine schwierige Frage stellten, dass es Zeit für einen Kaffee sei. So hielten sie uns erfolgreich davon ab, ihren Fragebogen gründlich in Augenschein zu nehmen, bis das Taxi (zu früh) kam, das uns zum Flughafen zurückbrachte .

